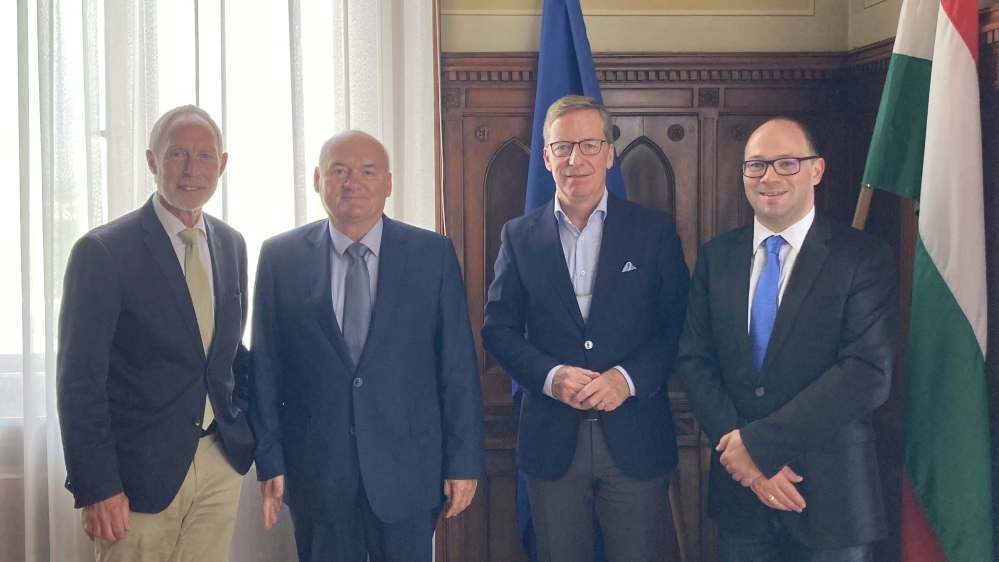Welche Zukunft hat die Soziale Marktwirtschaft? Diese Frage zum bewährten und vielbeachteten Wirtschaftssystem Deutschlands warf am 21. September 2023 Prof. Dr. Michael Hüther, renommierter Ökonom aus Deutschland, der an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht unterrichtet, weiterhin als Direktor das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) leitet, im Rahmen eines viertägigen Aufenthalts in Budapest am Mathias Corvinus Collegium in seinem Vortrag auf, der vom Deutsch-Ungarischen-Institut für Europäische Zusammenarbeit gemeinsam mit dem ungarischen Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung organisiert wurde. Das Thema mit dem gleichlautenden Titel „Welche Zukunft hat die Soziale Marktwirtschaft?“ stieß auf große Resonanz; insgesamt über 80 Personen wohnten dem Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion, welche im Scruton Cáfe des MCC stattfand, vor Ort oder live vor den Bildschirmen per Online-Zuschalte bei.
Nach einer kurzen Begrüßung, Einleitung und Vorstellung des Gastes, gehalten von Bence Bauer, Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts, folgte eine längere Einführung in das Thema durch Michael Winzer, den Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung, bei der die historische Signifikanz der Sozialen Marktwirtschaft als Erfolgsmodell der Nachkriegszeit, nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Gründungsgeschichte der CDU, deutlich wurde. Dabei hob er die wichtigsten Gründerväter, wie Konrad Adenauer und Ludwig Erhard hervor. Im Anschluss übernahm Frank Spengler, der ehemalige Leiter des Budapester KAS-Büros und derzeitiger Berater am Deutsch-Ungarischen Institut, die Moderation des Vortrages.
Inhaltlich orientierte sich Hüthers Vortrag an der Agenda seines 2022 erschienenen Buches, welches auch namensgebend dem Vortrag seinen Titel lieh. Dabei brachte er dem zum größten Teil ungarischen Publikum in fünf Punkten die deutsche Soziale Marktwirtschaft näher, wobei er diese mit einem Augenzwinkern – in Anspielung auf das Buch von Hedwig Richter „Demokratie eine deutsche Affäre“ – als eine deutsche Affäre bezeichnete. Er begann mit den Grundsätzen der bekannten britischen Ökonomen David Hume und Adam Smith und arbeitete dann in kurzer Form die historische Entwicklung der Wirtschaft vor und nach dem Zweiten Weltkrieg auf, um zu zeigen, warum die Soziale Marktwirtschaft gerade für die Deutschen so sympathisch gewesen sei. So hätten vor allem zwei Ereignisse – die Hyperinflation von 1923 und die Weltwirtschaftskrise ab 1929 – die Deutschen so nachhaltig geprägt, dass man die Auswirkungen bis heute spüre. So habe der Deutsche bis heute eine unterschwellige Angst vor den unkontrollierten Märkten und der Inflation weitervererbt. Die daraus resultierende Sicherheitspräferenz der deutschen Anleger sei die Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft, die er als die Versöhnungsidee der Prinzipien von Marktwirtschaft, Ordnungsstabilität sowie staatlicher Subsidiarität und Solidarität bezeichnete.
Im Blick auf die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft, sah Hüther jedoch auch einige Herausforderungen, die er in sechs Grundsatzfragen einfasste. Vor allem der Aufstieg Chinas und anderer nichtdemokratischer Mächte stelle eine große Herausforderung dar, da es fragwürdig sei, wie sehr die Soziale Marktwirtschaft auch ohne Demokratie funktionieren könne. So sei auch die Souveränität eines Staates mit einer freien Marktwirtschaft durch äußere Akteure gefährdet. Besonders interessant sei jedoch die Gefahr, die von einem Identitätsegoismus ausgehe, der sich in Deutschland entwickelt habe. In einer „Gesellschaft der Singularitäten“ gehe das Gefühl für das Allgemeinwohl verloren, was zu einer Ablehnung und daraus resultierenden Erosion gesellschaftlicher Standards führe.
In der darauffolgenden Fragerunde wurden weitere mögliche Herausforderungen diskutiert. Auf die Frage, ob Deutschland nun wieder der kranke Mann Europas sei, entgegnete Hüther, dass es durchaus große Herausforderungen gebe und es an Innovationspolitik zur Bekämpfung dieser mangele. Dadurch sehe Hüther durchaus in Bezug auf den demographischen Einbruch, der uns noch bevorstehe, ein Risiko für eine Stagflation über die nächsten Jahrzehnte. Hüther betonte jedoch auch, dass mit Ausnahme der USA dieses Schicksal jedoch so gut wie allen entwickelten Nationen drohe. Auch die Migrationspolitik Deutschlands in Bezug auf die Steigerung der Produktivität des Landes betrachtete Hüther als kritisch. So gebe es durchaus einen gewissen Prozentsatz, der nach wenigen Jahren gut in Wirtschaft und Gesellschaft integriert werden könne, es müsse jedoch auch konsequenter der Teil abgewiesen werden, der dies eben nicht tue.
In Anbetracht der Kombination von Herausforderungen, die auf die Wirtschaft der Bundesrepublik noch zukommen würden, prognostizierte Hüther, dass die Deutschen wohl wieder mehr arbeiten würden müssen, um diese zu stemmen. Die größten Probleme sah Hüther dabei nicht in dem Anteil der Beschäftigten per se, sondern in dem hohen Anteil der Teilzeitbeschäftigten unter diesen. Für Konzepte wie die Vier-Tage-Woche sah er ebenfalls keine Zukunft, so begründete er, ob dann beispielsweise Kitas auch nur vier Tage geöffnet haben sollten und wenn nicht, wo man dann die ausreichenden Kapazitäten für diese herholen wolle.
Während seines dreitägigen Aufenthalts in Budapest, traf er im Rahmen seines Besuchs- und Informationsprogramms eine Reihe von ungarischen und deutschen Fachpersönlichkeiten. Dazu gehörten Csaba Hende, der Vizepräsident der Ungarischen Nationalversammlung, Julia Gross, die Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Budapest, Barbara Zollmann, die Geschäftsführende Vorständin der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer, András Sávos, Präsident der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer, Dr. Roland Felkai, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer, sowie Prof. Dr. Stefan Okruch, Prorektor für Lehre und Studierende, Leiter des Lehrstuhls für Wirtschaftspolitik an der Andrássy Universität Budapest, Dr. Heinrich Kreft, Studiengangsleiter Internationale Beziehungen, Beauftragte des Rektors für Wirtschaftskontakte an der Andrássy Universität Budapest, Felix A. Dörstelmann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik an der Andrássy Universität Budapest. Darüber hinaus machte er Bekanntschaft mit dem Visiting Fellow des Deutsch-Ungarischen Instituts, Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll, Professor für Europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der TU Chemnitz.
Fotos: Tamás Gyurkovits MCC, Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer